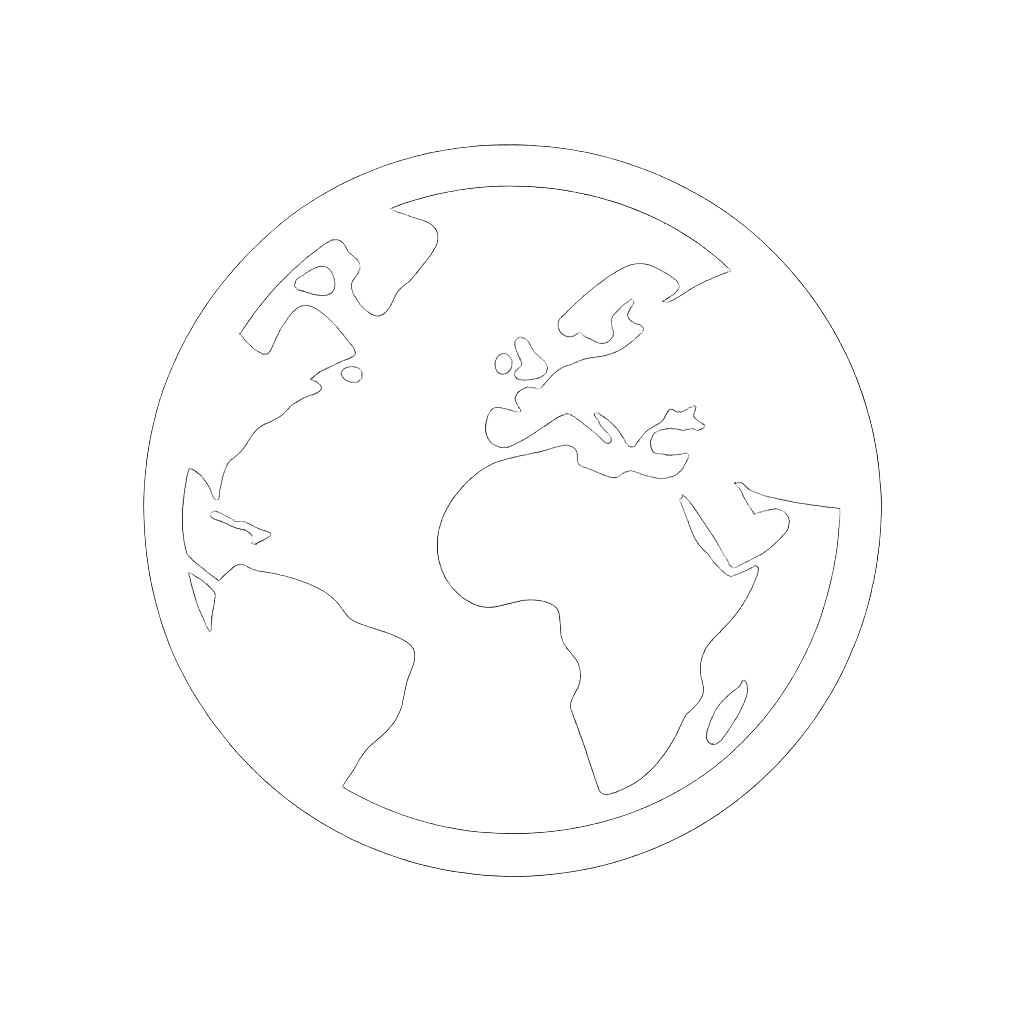Intro – Die Frage, die alles ruiniert hat
Es war keine große Eingebung.
Kein Geistesblitz.
Kein „Heureka!“.
Es war eher so ein stiller Moment, der sich über zwei Jahre hingezogen hat.
Ich bin zufällig über ein Verfahren gestolpert, das theoretisch ermöglichen soll, CO₂ wieder aus der Atmosphäre zu holen – nicht durch Bäume, nicht durch Kompensation, sondern technisch. Rückwärts. Umkehrbar. Greifbar.
CO₂-Abscheidung
Mein erster Gedanke war nicht: „Geil, wir retten die Welt.“
Mein erster Gedanke war:
„Das kann nicht stimmen.“
Also habe ich angefangen zu lesen.
Studien. Patente. Veröffentlichungen.
Nicht täglich. Nicht fanatisch.
Aber immer wieder.
Und jedes Mal blieb dieses leise, unangenehme Gefühl:
Es funktioniert. Zumindest theoretisch.
Irgendwann kam der nächste Gedanke dazu:
Wenn man CO₂ technisch wieder einfangen kann – was passiert dann damit?
Die Antwort: Man kann daraus wieder etwas machen.
Zum Beispiel Wasserstoff.
Wasserstoff
Nicht irgendeinen, sondern im Idealfall CO₂-negativen.
Spätestens da war ich innerlich schon zu weit drin, um es wieder loszuwerden. Ich habe gerechnet. Grob. Unsauber. Immer wieder verworfen. Neu gerechnet. Wieder verworfen.
Zwei Jahre lang habe ich diese Idee immer mal wieder aus der Schublade gezogen, sie bestaunt, gezweifelt, weitergeschoben.
Bis zu diesem einen Abend.
Ich saß mit meinem besten Kumpel zusammen – heute mein Geschäftspartner – und habe ihm das Ganze gezeigt. Keine PowerPoint. Keine Vision. Nur Zahlen, Skizzen, Annahmen, Fragezeichen.
Er hat lange nichts gesagt.
Sehr lange.
Dann hat er mich angeschaut und nur eine einzige Frage gestellt:
„Wenn das möglich ist… warum macht das dann keiner?“
Dieser Satz hat mehr beschädigt als jede Ablehnung, die später noch kommen sollte.
Denn plötzlich ging es nicht mehr darum, ob es funktioniert.
Sondern darum, warum es niemand ernsthaft macht.
Und ab diesem Moment war klar:
Das hier wird kein kurzer Gedanke mehr.
Und wahrscheinlich auch kein einfacher Weg.
Status am Ende dieser Episode:
Eine Idee ist kein Projekt.
Aber eine unbequeme Frage lässt sich verdammt schlecht wieder vergessen.
Episode 1 – Zwei Möglichkeiten, beide gleich schlecht
Nach dieser Frage –
„Warum macht das keiner?“ –
war mein erster Reflex kein rebellischer, sondern ein ziemlich nüchterner.
Eigentlich gibt es dafür nur zwei realistische Antworten.
Und beide haben denselben Kern:
Es ist nicht effizient.
Entweder:
- Es ist technisch möglich, aber viel zu teuer.
Oder: - Die Technik ist noch so experimentell, dass allein der Aufwand das Ganze wirtschaftlich zerlegt.
Unterschiedliche Ursachen, gleiches Ergebnis:
Man kann es nicht sinnvoll betreiben – zumindest nicht so, wie unser Wirtschaftssystem aktuell funktioniert.
Damit war diese erste große Idee fast schon wieder erledigt.
Nicht emotional.
Nicht dramatisch.
Einfach still beiseitegelegt mit dem inneren Vermerk:
„Spannend – aber nicht machbar.“
Und trotzdem ließ mich ein Gedanke nicht mehr los.
Warum betrachten wir CO₂ eigentlich nur als Problem –
und nicht als Rohstoff?
Wir recyceln heute fast alles:
- Papier
- Kunststoffe
- Metalle
- Beton
- Elektronik
Alles bekommt einen zweiten oder dritten Lebenszyklus.
Nur Kohlenstoff in der Atmosphäre nicht.
Der ist einfach da.
Zu viel davon.
Problematisch.
Und das war’s.
Dabei steckt darin chemisch betrachtet Energie.
Ein möglicher Ausgangsstoff.
Ein potenzieller Kreislauf.
Dieser Gedanke war für mich der eigentliche Bruch:
CO₂ nicht nur als Schuldigen zu sehen – sondern als Material.
Und genau an dieser Stelle ist die ursprüngliche technische Idee endgültig an der Realität gescheitert.
Nicht, weil sie physikalisch unmöglich war.
Sondern, weil sie wirtschaftlich keinen Platz hatte.
Und dann kam dieser eine, trockene Gedanke, der alles verschoben hat:
Vielleicht muss CO₂-Recycling gar nicht wirtschaftlich sein.
Vielleicht ist sein Nutzen größer als die Logik, in der es sich gerade rechnen soll.
Das war der Moment, in dem sich der Fokus unmerklich verschoben hat:
Nicht mehr:
„Wie machen wir das profitabel?“
Sondern:
„Wie kann man so etwas überhaupt finanzieren, wenn es sich nicht rechnen darf?“
Und genau hier – noch ohne Plattform, ohne Businessmodell, ohne Plan –
ist zum ersten Mal der Gedanke entstanden,
nicht das Recycling selbst zu lösen,
sondern seine Finanzierung.
Status am Ende dieser Episode:
Die ursprüngliche Projektidee war faktisch tot.
Aber das eigentliche Problem hatte gerade erst begonnen.
Episode 2 – Geld, das keiner geben will
Uns war ziemlich früh klar, dass das hier kein Projekt ist, für das jemand mal eben einen großen Scheck ausstellt.
Nicht, weil niemand Geld hat.
Sondern, weil die Summen in einer Größenordnung liegen, bei der jedes Gespräch sofort gleich endet:
- zu hohes Risiko
- zu lange Amortisation
- kein klassischer Markt
- keine Sicherheit
Und dazu kam noch etwas anderes, fast Wichtigeres:
Selbst wenn jemand das Geld hätte – wir wären nicht bereit gewesen, dieses Risiko jemandem aufzubürden.
Trotzdem ließ uns das Thema nicht mehr los.
Nicht rational.
Nicht strategisch.
Sondern eher auf diese unangenehme Art, bei der man merkt:
Man denkt ständig darüber nach, obwohl man es eigentlich längst verworfen hat.
Und dann kam die Lösung nicht aus der Finanzwelt.
Nicht aus einer Business-Idee.
Nicht aus einem Pitchdeck.
Sie kam aus dem Smartphone.
Wir kannten diese Apps, bei denen man durch Werbung Geld sammelt und für etwas Gutes spendet. Man schaut sich einen Spot an, ein paar Cent wandern in einen virtuellen Topf – und irgendwann unterstützt man damit ein Projekt. Keine eigene Zahlung, kein Abo, keine Kreditkarte. Nur Aufmerksamkeit.
Und irgendwann haben wir uns gefragt:
Warum funktioniert das eigentlich nicht für ein einziges, klar definiertes Thema?
Keine Auswahl aus hundert Organisationen.
Kein Verteilungschaos.
Keine beliebigen Zwecke.
Nur:
CO₂-Recycling. Punkt.
Damit war zum ersten Mal klar:
Wir wollten nicht zuerst ein technisches Projekt finanzieren –
sondern eine Maschine für Aufmerksamkeit bauen, die Geld erzeugt.
Werbung wird geschaut.
Werbung erzeugt Einnahmen.
Einnahmen fließen in genau eine Richtung.
Später kam noch ein zweiter Gedanke dazu:
Diese Mechaniken aus Apps, bei denen man durch kleine Aufgaben, Klicks oder Aktionen Werte sammelt. Nicht als Zockerei. Nicht als Spiel. Sondern als niedrigschwellige Beteiligung.
Und irgendwann war der Gedanke nicht mehr wegzukriegen:
Wenn sowieso jeder ständig ein Smartphone in der Hand hat –
warum sollte man es nicht genau dort ermöglichen, dieses Projekt zu unterstützen?
Damit war die Idee einer reinen Website plötzlich zu klein.
Aus einer Plattform wurde langsam der Gedanke an eine App.
Nicht aus Größenwahn – sondern aus Erreichbarkeit.
In diesem ganzen Prozess habe ich mich selbst weiter mit CO₂-Recycling beschäftigt.
Und je tiefer ich geschaut habe, desto klarer wurde:
Die Technik ist längst nicht mehr Science-Fiction.
Es gibt Verfahren.
Es gibt Menschen, die daran arbeiten.
Aber fast immer:
- isoliert
- langsam
- unterfinanziert
Alle reden vom Vermeiden.
Vom Speichern.
Von Zwischenlagern.
Von Endlagern.
Aber das eigentliche Potenzial – CO₂ als nutzbarer Rohstoff –
schleppt hinterher.
Nicht, weil es unmöglich ist.
Sondern, weil es sich nicht schnell genug rechnet.
Und genau an diesem Punkt ist unsere ursprüngliche Einzelidee endgültig aufgegangen in etwas Größerem:
Nicht mehr:
„Wir finanzieren ein Projekt.“
Sondern:
„Wir schaffen eine Plattform, die grundsätzlich CO₂-Recycling finanziert.“
Nicht für den schnellen Gewinn.
Nicht für Investorenrendite.
Sondern, damit diese Technik überhaupt die Chance bekommt, zu wachsen.
Status am Ende dieser Episode:
Aus einer technischen Idee ist eine Finanzierungsfrage geworden.
Aus einem Projekt ein Prinzip.
Und aus einer Website langsam der Gedanke an eine App.
Episode 3 – Keine Zeit. Keine Ahnung. Beste Voraussetzungen.
Die Idee stand im Raum.
Die Richtung war klar.
Die Mechanik greifbar.
Und dann kam das, worüber man in keinem Pitchdeck gerne spricht:
Der Alltag.
Jan arbeitet im Schnitt zehn bis elf Stunden am Tag.
Ich eher dreizehn bis vierzehn.
Nicht gelegentlich.
Nicht in Spitzenzeiten.
Sondern regelmäßig.
Das sind Tage, an denen man abends nicht mehr kreativ ist.
Nicht visionär.
Nicht mutig.
Man ist einfach nur noch… müde.
Und genau in diese Realität hinein fiel der Gedanke:
„Dann bauen wir das halt.“
Nicht mit Agentur.
Nicht mit Team.
Nicht mit Budget.
Sondern selbst.
Das Problem dabei:
Wir konnten nichts davon.
Keine App.
Keine Website.
Kein Backend.
Kein Frontend.
Nicht mal ansatzweise.
Wir standen da mit:
- einer Idee,
- einer Finanzierungslogik,
- einem gesellschaftlichen Thema,
- und exakt null technischer Kompetenz.
Also nicht „wenig“.
Nicht „Grundkenntnisse“.
Sondern wirklich: von null.
Und nebenbei ein Arbeitsalltag, der eigentlich keine freien Abende mehr übrig ließ, sondern nur noch Lücken zwischen zwei Erschöpfungsphasen.
Das war der erste echte Moment, in dem klar wurde:
Das hier wird kein Projekt, das man „nebenbei“ macht.
Denn plötzlich ging es nicht mehr um CO₂, Finanzierung oder Mechaniken –
sondern um sehr banale Fragen:
- Wann lernen wir das?
- Wie lernen wir das?
- Und vor allem: Woher nehmen wir die Konzentration dafür?
Denn Programmieren lernt man nicht zwischen Tür und Angel.
Nicht zwischen zwei Terminen.
Nicht zwischen 21:30 Uhr und dem Einschlafen auf der Couch.
Und trotzdem haben wir genau dort angefangen:
abends. müde. ohne Plan.
Nicht, weil es klug war.
Sondern, weil das Projekt zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr aus dem Kopf ging.
Status am Ende dieser Episode:
Die Idee war da.
Die Mechanik war da.
Die Zeit nicht.
Das Wissen nicht.
Und trotzdem haben wir angefangen.
Episode 4 – Wir sind kein Klimaschutzprojekt
Wir haben mit dem Schwersten angefangen.
Nicht strategisch.
Nicht klug.
Einfach direkt mit der App.
Warum?
Weil wir dachten, genau da liegt der Schlüssel.
Die Programmierung war dabei von Anfang an Jans Spielfeld.
Und unser wichtigstes Werkzeug in dieser Phase war nicht ein Framework, kein Kurs, keine Agentur –
sondern die KI.
Sie war unser Erklärer.
Unser Übersetzer.
Unser geduldiger Gegenüber, wenn wir nachts völlig übermüdet irgendeinen Fehler nicht verstanden haben.
Die ersten Designs, die ersten Farben, die ersten Oberflächen stammen noch aus dieser ganz frühen Phase –
aus der Zeit, in der es eigentlich noch um ein einzelnes Projekt ging.
Die Farbgebung war angelehnt an eine technische Anlage.
Sachlich.
Kühl.
Fast industriell.
Und irgendwann, mitten in diesem ganzen Lernprozess, ist uns etwas Entscheidendes klar geworden:
Wir sind keine Klimaschützer.
Nicht im aktivistischen Sinn.
Nicht im moralischen Sinn.
Nicht im appellierenden Sinn.
Wir wollen:
- niemandem Angst machen
- niemandem Schuld zuweisen
- niemandem versprechen, die Welt zu retten
Was wir tun – ganz nüchtern betrachtet – ist Recycling.
Kein Banner.
Kein Slogan.
Keine Parolen.
Technik.
Und damit war auch klar:
Wir bleiben in unserer gesamten Kommunikation technisch.
- faktenbasiert
- nüchtern
- ohne Klimaversprechen
- ohne emotionale Eskalation
Und genau deshalb ist unsere Farbgebung auch so, wie sie ist:
Nicht grün.
Nicht „ökologisch“.
Nicht „Umwelt“.
Sondern eher:
Maschine statt Moral.
Das war kein Marketingbeschluss.
Das war ein Selbstverständnis, das sich erst im Machen ergeben hat.
Wir finanzieren keine Ideologien.
Wir finanzieren Technik.
Status am Ende dieser Episode:
Die App war unser erster technischer Anlauf.
Die KI unser wichtigster Helfer.
Und unser Selbstbild hat sich endgültig verschoben:
Weg vom Klimathema – hin zum Recycling als technische Aufgabe.
Episode 5 – Der Punkt, an dem unsere Grenzen sichtbar wurden
Wir hatten angefangen.
Mit der App.
Mit KI als Werkzeug.
Mit viel Ehrgeiz und sehr wenig Zeit.
Und eine ganze Weile fühlte sich das auch so an, als würde es funktionieren.
Nicht schnell.
Nicht sauber.
Aber irgendwie vorwärts.
Bis zu dem Punkt, an dem wir gemerkt haben:
Das hier ist kein Bastelprojekt.
Nicht, weil etwas „kaputt“ war.
Nicht, weil ein einzelner Fehler alles blockiert hat.
Sondern, weil sich langsam ein Gefühl eingeschlichen hat, das man schwer greifen kann:
Man arbeitet viel.
Man liest viel.
Man probiert viel.
Aber der Abstand zwischen Idee und funktionierendem System bleibt erstaunlich groß.
Das war der Moment, in dem uns klar wurde:
- App-Entwicklung ist nicht nur „Programmieren“
- Es ist Struktur
- Architektur
- Datenflüsse
- Sicherheit
- Logik
- Zustände
- Abhängigkeiten
Und plötzlich war das Ganze nicht mehr:
„Wir bauen das schnell zusammen.“
Sondern:
„Wir betreten hier ein System, das uns dauerhaft überfordert, wenn wir es nicht sauber angehen.“
Das war kein lauter Bruch.
Kein Scheitern.
Kein Abbruch.
Eher so ein stilles Innehalten.
Zum ersten Mal stand nicht mehr die Idee im Vordergrund.
Sondern die Frage:
Wie realistisch ist eigentlich unser eigener Anspruch – unter diesen Bedingungen?
Und genau dieser Moment war wichtig.
Nicht entmutigend.
Sondern klärend.
Denn hier begann langsam eine neue Phase:
Nicht mehr nur „machen“,
sondern „strukturieren“.
Status am Ende dieser Episode:
Wir waren technisch gestartet.
Aber wir hatten noch keinen technischen Boden unter den Füßen.
Nachtrag zu Episode 5 – Zwei Wochen wegen eines Zeichens
Es gab dann doch diesen einen konkreten Punkt, an dem alles plötzlich sehr real wurde.
Jan hing an einem Fehler.
Nicht spektakulär.
Kein Systemabsturz.
Keine kaputte Datenbank.
Ein Zeichen.
Ein einziges, falsch gesetztes Zeichen im Code.
Und dieses eine Zeichen hat dafür gesorgt, dass:
- nichts mehr sauber lief
- nur noch Fehlermeldungen kamen
- nichts verständlich erklärbar war
- jede neue Idee sofort wieder im Nichts verpufft ist
Zwei Wochen lang.
Zwei Wochen Suchen.
Zwei Wochen Zweifeln.
Zwei Wochen dieses leise, zermürbende Gefühl:
„Ich verstehe nicht, warum das nicht geht.“
Nicht aus Faulheit.
Nicht aus Unwissen allein.
Sondern, weil du manchmal einfach auf den Code starrst –
und dein Gehirn dir nicht mehr sagt, was da eigentlich steht.
Bis irgendwann klar wurde:
Es war wirklich nur ein Zeichen.
Kein großer Architekturfehler.
Kein konzeptioneller Totalschaden.
Nur ein winziger Punkt an der falschen Stelle.
Und genau dieser Moment hat uns mehr über dieses Projekt beigebracht als viele theoretische Überlegungen vorher:
Es sind nicht immer die großen Probleme, die dich aufhalten.
Manchmal sind es die winzigsten.
Und sie kosten trotzdem Zeit.
Nerven.
Energie.
Ergänzter Status zu Episode 5:
Wir hatten nicht nur keinen technischen Boden –
wir hatten gerade gelernt, wie brutal klein die Stolperfallen sein können.
Episode 6 – Zwei Leben, ein Projekt, null freie Zeit
Irgendwann kam dieser Moment, den man nicht planen kann –
man merkt einfach irgendwann, dass man ständig gedanklich bei einem Projekt ist, für das man eigentlich gar keine Zeit hat.
Tagsüber lief das normale Leben.
Arbeit. Termine. Verantwortungen.
Bei Jan zehn bis elf Stunden.
Bei mir eher dreizehn bis vierzehn.
Kein Startup-Lifestyle.
Kein „Jetzt reißen wir alles ab“.
Sondern genau das Gegenteil: volle Verantwortung – und danach erst das Projekt.
Das führte zu einer sehr seltsamen Situation:
Man lebt zwei Leben gleichzeitig.
Eins, das Rechnungen bezahlt.
Und eins, das eigentlich Zukunft bauen will.
Und beide konkurrieren um dieselbe Ressource:
Aufmerksamkeit.
Abends auf der Couch war man nicht mehr kreativ.
Nicht mehr mutig.
Oft nicht mal mehr geduldig.
Und trotzdem:
Die App, die Idee, die Plattform – all das ließ sich nicht einfach ausschalten wie ein Browser-Tab.
Man denkt drüber nach beim Zähneputzen.
Beim Autofahren.
Zwischen zwei Terminen.
Kurz vor dem Einschlafen.
Nicht dauerhaft euphorisch.
Eher unterschwellig hartnäckig.
Und genau daraus entstand langsam ein innerer Konflikt:
Entweder wir hören damit auf –
oder wir müssen anfangen, dafür bewusst Platz zu schaffen.
Denn „nebenbei“ war inzwischen klar:
So wird daraus nichts Tragfähiges.
Status am Ende dieser Episode:
Das Projekt war nicht mehr nur eine Idee.
Es war ein zweites, unbezahltes Leben geworden.
Episode 7 – Wir können nicht einfach aussteigen
Irgendwann war uns klar, was das eigentliche Problem ist.
Nicht die Technik.
Nicht die App.
Nicht das Wissen.
Sondern:
Wir können nicht einfach aussteigen.
Jan sitzt in einer Führungsposition.
Ich führe einen eigenen Betrieb. Acht Mitarbeiter. Verantwortung. Löhne. Kunden. Laufende Verpflichtungen.
Das hier ist kein:
„Wenn’s klappt, kündigen wir halt.“
Das hier ist:
„Wenn wir gehen, fällt mehr um als nur unser eigener Schreibtisch.“
Und damit fiel auch der letzte romantische Rest von Startup-Idee weg.
Kein:
- „Wir gehen all-in.“
- „Wir machen jetzt nur noch das.“
- „Wir setzen alles auf eine Karte.“
Das war schlicht keine Option.
Stattdessen blieb nur eine einzige realistische Zielsetzung übrig:
Dieses Projekt muss anfangen, sich selbst zu tragen –
bevor wir uns ihm vollständig widmen können.
Nicht irgendwann.
Nicht idealerweise.
Sondern ganz nüchtern:
Damit wir überhaupt die Freiheit bekommen, es ernsthaft weiterzuführen.
Die Ausgangslage dafür war… überschaubar:
- kaum Zeit
- sehr wenig technisches Wissen
- kein Budget
- volle berufliche Verpflichtungen
Aber gleichzeitig war auch klar:
Aufhören kommt nicht mehr infrage.
Also war der Plan kein heroischer mehr.
Kein riskanter.
Kein spektakulärer.
Sondern ein stiller, sehr nüchterner:
Mit den Mitteln weiterkommen, die wir haben –
bis dieses Projekt irgendwann auf eigenen Beinen stehen kann.
Nicht, um reich zu werden.
Nicht, um etwas zu beweisen.
Sondern, um irgendwann ohne Zweifel, ohne Existenzangst, ohne innere Zerrissenheit sagen zu können:
„Das hier ist jetzt unser Fokus.“
Status am Ende dieser Episode:
Wir konnten nicht abspringen.
Also mussten wir anfangen, das Projekt so zu bauen,
dass es uns eines Tages freistellen kann.
Episode 8 – Einfach weitermachen
Es gab keinen großen Neustart.
Keine neue Strategie.
Keinen radikalen Schnitt.
Wir haben einfach weitergemacht.
So, wie unsere Zeit es eben zugelassen hat.
Mal ein Abend.
Mal ein Wochenende.
Mal zwei Wochen gar nichts, weil dazwischen einfach kein Platz war.
Kein Sprint.
Eher ein stetiges, langsames Vorwärtskriechen.
Code hier.
Eine Idee dort.
Ein verworfener Ansatz.
Ein neuer Versuch.
Und irgendwann – ohne dass es sich besonders angefühlt hätte –
standen wir plötzlich vor etwas, das man vorsichtig so nennen konnte:
Ein halbwegs laufender App-Prototyp.
Nicht schön.
Nicht rund.
Nicht „fertig“.
Aber:
- bedienbar
- nachvollziehbar
- real
Zum ersten Mal war das Projekt nicht mehr nur eine Vorstellung im Kopf,
sondern etwas, das man auf einem Bildschirm sehen konnte.
Und genau an dieser Stelle kam der nächste, sehr nüchterne Gedanke:
Nur weil wir etwas gebaut haben, heißt das nicht,
dass irgendjemand davon erfährt.
Bis hierher hatte sich alles um Technik gedreht.
Um Umsetzbarkeit.
Um Machbarkeit.
Jetzt kam eine völlig andere Frage auf den Tisch:
Wie erreicht man eigentlich Menschen,
wenn man kein Geld für Reichweite hat?
Denn eine App auf dem eigenen Handy bringt niemandem etwas –
außer uns selbst.
Also haben wir angefangen, nicht mehr nur über Funktionen nachzudenken,
sondern über etwas, das wir bis dahin eher ausgeklammert hatten:
Verbreitung. Sichtbarkeit. Aufmerksamkeit.
Nicht im Sinne von Hype.
Nicht viral.
Nicht laut.
Sondern erstmal ganz grundlegend:
Wie kommt so etwas überhaupt in die Welt?
Status am Ende dieser Episode:
Die Technik lief zum ersten Mal ansatzweise.
Und damit war klar: Das nächste große Problem wird nicht der Code sein –
sondern die Frage, wie man überhaupt gesehen wird.
Episode 9 – Die fremde Welt
Ab einem gewissen Punkt ließ sich das Ganze nicht mehr sauber auseinanderziehen.
Nicht mehr in klare Schritte.
Nicht mehr in logisch geordnete Phasen.
Es fing an, gleichzeitig in mehrere Richtungen zu wachsen –
im Kopf, im Alltag, im Projekt.
Man dachte morgens an Funktionen.
Mittags an Reichweite.
Abends an Finanzierung.
Nachts an die Frage, ob das alles überhaupt irgendwer sehen wird.
Und dann kristallisierte sich langsam eine ziemlich nüchterne Erkenntnis heraus:
Wenn wir keine Reichweite kaufen können,
bleibt eigentlich nur Reichweite leihen.
Damit war zum ersten Mal ein Wort ernsthaft auf dem Tisch,
das bisher nie Teil unseres Denkens war:
Influencer.
Nicht aus Begeisterung.
Nicht aus Trenddenken.
Sondern aus reiner Logik.
Denn egal, wie gut oder schlecht unsere Plattform ist –
wenn sie niemand kennt, ist sie schlicht nicht existent.
Und in unserer Wahrnehmung gab es zu diesem Zeitpunkt nur eine Werbemacht,
die ohne riesige Budgets überhaupt noch durchdringen konnte:
Menschen mit Reichweite.
Profile.
Kanäle.
Communitys.
Das Problem dabei war nur:
Das ist nicht unsere Welt.
Wir kannten:
- Technik
- Prozesse
- Zahlen
- Systeme
Aber:
- keine Creator-Strukturen
- keine Deals
- keine Mechaniken
- keine Spielregeln dieser Szene
Für uns war diese Influencer-Welt kein Werkzeugkasten,
sondern ein komplett fremdes Ökosystem.
Und trotzdem war klar:
Wenn wir wollen, dass dieses Projekt außerhalb unserer eigenen Köpfe existiert,
müssen wir uns genau dort hineinbewegen.
Nicht aus Überzeugung.
Nicht aus Leidenschaft.
Sondern, weil es der einzige realistische Weg war, den wir zu diesem Zeitpunkt sehen konnten.
Status am Ende dieser Episode:
Die Technik lief.
Die Idee stand.
Und plötzlich standen wir vor einer Welt,
in der wir uns genauso wenig auskannten
wie am ersten Tag im Code.
Episode 10 – Kein Pitch für Reichweite, sondern für Vertrauen
Irgendwann – zwischen all den Gesprächen über Reichweite, Sichtbarkeit und diese fremde Influencer-Welt – fiel uns etwas ein, das wir vorher nicht als echten Ansatz gesehen hatten.
Es gab da jemanden.
Kein enger Freund.
Kein Teil unseres Alltags.
Eher so ein Mensch aus dem erweiterten Dunstkreis.
Ich hatte ihn zwei- oder dreimal bei Treffen mit Freunden gesehen.
Sympathisch.
Unaufgeregt.
Angenehm.
Jan kannte ihn nicht einmal persönlich – nur aus meinen Erzählungen.
Und trotzdem kam irgendwann dieser Gedanke auf:
Das ist kein Fremder. Aber eben auch kein Freund.
Sondern genau diese merkwürdige Zwischenstufe.
Und genau das hat es so kompliziert gemacht.
Denn das, was wir vorhatten, war kein:
- „Mach doch mal zwei Posts für uns.“
- „Erwähn uns mal in deiner Story.“
- „Wir zahlen dir was für Reichweite.“
Das hier war etwas völlig anderes.
Es war eher:
Ein Onboarding.
Ein vorsichtiges Abklopfen.
Ein möglicher Einstieg ins Team.
Nicht, weil wir direkt Personal gesucht hätten.
Sondern, weil uns klar war:
Wenn wir in diese Welt rein wollen,
brauchen wir jemanden, der dort zu Hause ist.
Jemanden, der:
- die Spielregeln kennt
- die Denkweise versteht
- weiß, wie man Reichweite nicht nur bekommt, sondern auch hält
Und gleichzeitig war dieser Mensch jemand, bei dem wir zumindest ein Grundvertrauen hatten. Kein blindes. Kein tiefes. Aber mehr, als man einem völlig Fremden entgegenbringt.
Die Treffen im Vorfeld waren alle angenehm gewesen.
Kein Bauchgrummeln.
Kein schräges Gefühl.
Also entstand langsam ein Gedanke, der sich erst komisch anfühlte – und dann logisch:
Vielleicht geht es hier gar nicht um „Influencer buchen“.
Vielleicht geht es darum, jemanden dazuzuholen.
Nicht für eine Kampagne.
Nicht für einen Deal.
Sondern für genau den Teil des Projekts,
von dem wir selbst am wenigsten verstanden.
Und damit war dieses Gespräch, das bevorstand,
kein Marketinggespräch mehr.
Es war auch kein Verkaufsgespräch.
Es war:
Ein vorsichtiges Abtasten,
ob aus einer entfernten Bekanntschaft
vielleicht ein gemeinsamer Weg werden kann.
Status am Ende dieser Episode:
Wir wollten keine Reichweite einkaufen.
Wir wollten jemanden ins Boot holen,
der uns durch eine Welt führen kann,
in der wir uns selbst nicht auskennen.
Episode 11 – Wie viel darf man eigentlich erzählen?
Bevor dieses erste Gespräch überhaupt stattgefunden hat,
haben wir es gedanklich wahrscheinlich zehnmal geführt.
Nicht laut.
Nicht gemeinsam.
Sondern jeder für sich.
Was erzählt man?
Was lieber nicht?
Wo beginnt Vertrauen – und wo Naivität?
Denn so ein Moment hat immer auch eine dunkle Seite:
Da sitzt jemand mit Reichweite.
Mit Erfahrung in dieser Welt.
Mit Geschwindigkeit.Und man selbst sitzt da mit einer Idee,
in die man schon viel zu viel Energie gesteckt hat,
um sie leichtfertig aus der Hand zu geben.
Natürlich denkt man da auch an genau diesen Gedanken:
Was, wenn er sagt:
„Super Idee – ich mache das einfach selbst“?
Nicht aus Bosheit.
Sondern, weil es technisch vielleicht schneller geht.
Weil man die richtigen Leute kennt.
Weil man die Reichweite hat.
Und plötzlich steht man da mit einer Frage,
die man sich vorher nie stellen wollte:
Wie erklärt man sein eigenes Projekt,
ohne es komplett preiszugeben?
Wir sind gedanklich alles durchgegangen:
- Reicht es, das Prinzip so zu erklären,
wie ich es damals Jan erklärt habe – mit Skizzen? - Wie viel Technik erklärt man überhaupt,
ohne jemanden direkt zu überfordern? - Erklärt man erst die Plattform –
oder erst das Thema CO₂-Recycling? - Setzt man voraus, dass die andere Person davon noch nie gehört hat?
Denn wir sind genau davon ausgegangen:
Diese Welt ist den meisten Menschen völlig fremd.
Und je mehr wir darüber nachgedacht haben,
desto klarer wurde:
Das hier ist kein normales Vorstellungsgespräch.
Kein Pitch.
Kein Verkauf.
Es ist ein vorsichtiges gegenseitiges Abtasten.
Zwischen:
- dem Wunsch, alles offen zu zeigen
- und der Angst, zu viel zu zeigen
Zwischen:
- „Wir brauchen dich“
- und
- „Wir dürfen uns nicht komplett entblößen“
Am Ende blieb kein perfekter Plan.
Keine saubere Gesprächsstrategie.
Kein Sicherheitsnetz.
Nur diese eine Entscheidung:
Wir erzählen so viel,
dass man das Prinzip versteht –
aber nicht so viel,
dass wir unsere innere Kontrolle verlieren.
Status am Ende dieser Episode:
Das Gespräch stand fest.
Die Nervosität auch.
Und die größte Unsicherheit war nicht die Technik –
sondern das eigene Vertrauen.
Episode 12 – Der Zweifel stand plötzlich auf der anderen Seite
Am Ende haben wir all die gedanklichen Gesprächsstrategien verworfen.
Keine Checkliste.
Kein Ablaufplan.
Kein „Das sagen wir – das nicht“.
Wir haben uns gesagt:
Es ist unser Projekt.
Wenn wir es nicht frei erklären können,
wie soll es dann irgendwer verstehen?
Also sind wir einfach reingegangen –
aus dem Bauch heraus.
Wir haben erklärt, dass CO₂-Recycling grundsätzlich möglich ist.
Die Reaktion kam prompt.
Ungläubig.
Neugierig.
Skeptisch.
„Wie bitte? Das geht?“
Dann haben wir vorsichtig ein paar technische Details erzählt.
Nicht zu tief.
Nicht zu abstrakt.
Gerade so dosiert, dass es nicht überfordert.
Und genau das hat etwas ausgelöst, womit wir gerechnet hatten –
nur anders als erwartet:
Die Neugier war plötzlich da.
Und sie wurde schnell größer.
Er wollte mehr wissen.
Mehr Technik.
Mehr Hintergründe.
Mehr Tiefe.
Ich habe das Gespräch an dieser Stelle bewusst gebremst.
Nicht, weil es uninteressant gewesen wäre.
Sondern, weil uns klar war:
Wenn wir jetzt in die Technik abtauchen,
kommen wir heute nicht mehr zurück.
Also haben wir gesagt:
Heute geht es nicht um Verfahren, Reaktoren oder Chemie.
Heute geht es nur um die Plattform.
Alles andere ist Zukunftsmusik.
Dann haben wir ihm gezeigt,
was wir bis dahin überhaupt hatten:
- den Prototyp
- die Idee der App
- das Prinzip der Werbefinanzierung
- unsere Vorstellung vom Außenauftritt
- unsere bewusste, nüchterne Kommunikation
- kein Klimaschutz-Pathos
- keine Parolen
- nur Technik und Recycling
Und genau in diesem Moment hat das Gespräch eine völlig unerwartete Wendung genommen.
Wir waren innerlich auf alles vorbereitet gewesen:
- auf Zweifel an unserer Kompetenz
- auf Skepsis gegenüber der Idee
- auf kritische Fragen zur Umsetzbarkeit
- auf Misstrauen
Aber das alles kam nicht.
Stattdessen kam etwas, womit wir nicht gerechnet hatten:
**Er hat nicht daran gezweifelt,
ob wir die Richtigen sind.Er hat daran gezweifelt,
ob er selbst der Richtige ist.**
Nicht aus Arroganz.
Nicht aus Ablehnung.
Sondern aus Unsicherheit.
Ob er dem Thema gerecht werden kann.
Ob er es glaubhaft transportieren kann.
Ob er dieser Verantwortung überhaupt entspricht.
Das war einer dieser Momente,
in denen sich ein Gespräch innerlich komplett neu sortiert.
Denn plötzlich ging es nicht mehr um:
„Passen wir zu dir?“
Sondern um:
„Willst du dir das hier wirklich zutrauen?“
Status am Ende dieser Episode:
Wir waren nicht mehr die Bewerbenden.
Der Zweifel hatte die Seite gewechselt.
Episode 13 – Begeistert. Und trotzdem kein Ja.
Wir waren auf vieles vorbereitet gewesen.
Auf Skepsis.
Auf Ablehnung.
Auf Zurückhaltung.
Was wir nicht erwartet hatten, war genau diese Kombination:
Begeisterung – ohne Zusage.
Für den Fall, dass das Gespräch grundsätzlich positiv läuft,
hatten wir bereits einen Vertrag vorbereitet.
Nicht als Druckmittel.
Nicht als Falle.
Sondern als klares Signal:
Wir suchen keine Werbefigur.
Wir suchen einen Partner.
Ein echtes Teammitglied.
Wir haben ihm den Vertrag gezeigt.
Ihm erklärt, wie wir uns die Zusammenarbeit vorstellen.
Welche Rolle wir sehen.
Welche Verantwortung.
Ich hätte erwartet, dass genau das Sicherheit gibt.
Stattdessen passierte das Gegenteil.
Die Unsicherheit wurde spürbar größer.
Nicht auf unserer Seite.
Auf seiner.
Er fand das Projekt gut.
Er fand die Idee stark.
Er war sichtbar interessiert.
Und trotzdem kam am Ende kein klares Ja.
Stattdessen kam etwas ganz anderes:
Er braucht Zeit.
Er muss nachdenken,
ob er den passenden Content dafür liefern kann.
Ob er das Thema glaubwürdig transportieren kann.
Ob er langfristig nicht nur eigenen Content schafft,
sondern auch mit anderen Influencern verhandeln,
Kooperationen aufbauen,
Gespräche führen kann.
Damit endete das Gespräch.
Kein Bruch.
Kein Konflikt.
Kein Abschied.
Sondern:
Ein offenes Ende.
Und genau das hat uns mit sehr gemischten Gefühlen zurückgelassen.
Einerseits:
Es war ein gutes Gespräch.
Ein ehrliches Gespräch.
Ein respektvolles Gespräch.
Wir hatten beide dieses Gefühl:
Das ist eigentlich genau der Richtige für diese Position.
Alles andere würde komplizierter werden.
Langsamer.
Umständlicher.
Auf der anderen Seite war da etwas, das schwer zu greifen war.
Nicht Enttäuschung.
Nicht Ablehnung.
Nicht Frust.
Eher so eine Form von:
Irritation.
Jemand, der erfolgreich ist in dem, was er tut.
Der Reichweite hat.
Der in seiner Welt funktioniert.
Und der trotzdem an sich zweifelt –
genau bei der Aufgabe, die eigentlich sein eigenes Feld ist.
Ich hatte eher damit gerechnet,
dass wir skeptisch betrachtet würden.
Nicht andersherum.
Dieser Zustand der Schwebe,
den wir an diesem Abend mit nach Hause genommen haben,
war neu.
Und er fühlte sich seltsam an.
Status am Ende dieser Episode:
Das Gespräch war gut.
Die Richtung fühlte sich richtig an.
Aber die Antwort blieb offen.
Episode 14 – Während wir warteten, bauten wir weiter
Dieses Gefühl blieb.
Kein hundertprozentiges Verständnis für seine Reaktion.
Aber auch kein schlechtes Gefühl.
Eher so etwas wie:
„Das war kein Nein.“
Und irgendetwas daran fühlte sich sogar richtig an.
Es hat uns in einer seltsamen Weise eher darin bestärkt,
dass wir hier vermutlich genau den Menschen gefunden hatten,
den wir für diesen Part wirklich brauchen würden —
auch wenn wir ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht hatten.
Aber wir konnten an dieser Situation nichts ändern.
Und also haben wir das Einzige getan,
was wir in solchen Momenten immer tun:
Wir haben weitergemacht.
Das Produkt war noch nicht fertig.
Die App war noch im Aufbau.
Die Vermarktung war offen.
Aber genau deshalb war es auch kein Drama,
dass dieser Teil noch nicht entschieden war.
Denn:
Was nicht fertig ist, muss auch noch nicht beworben werden.
Und irgendwo in genau dieser Phase entstand dann der nächste klare Gedanke:
Eine App allein reicht nicht.
Nicht für Vertrauen.
Nicht für Sichtbarkeit.
Nicht für Verständlichkeit.
Es braucht etwas, das größer ist als ein Icon auf einem Handy.
Etwas, das man teilen kann.
Erklären kann.
Nachschlagen kann.
Keine bloße Landingpage.
Kein Werbeplakat.
Sondern:
Ein echtes Portal.
Also nicht nur:
- Mobilanwendung
sondern auch: - Website
Zwei Zugänge.
Ein Gedanke.
Und damit stand plötzlich eine neue Frage im Raum:
Wie soll dieses Ding eigentlich heißen?
Uns war klar:
Das hier wird kein rein deutsches Projekt bleiben können.
Nicht, weil wir größenwahnsinnig wären.
Sondern, weil das Problem schlicht nicht an Landesgrenzen hält.
CO₂ ist global.
Also muss auch der Gedanke global funktionieren.
Der Name sollte:
- international verständlich sein
- nicht technisch abstoßend wirken
- nicht ideologisch klingen
- nicht nach NGO
- nicht nach Aktivismus
- nicht nach Werbeplattform
Er sollte möglichst ruhig sein.
Und trotzdem eine Größe in sich tragen.
Nach viel Grübeln, Verwerfen, Diskutieren und Recherchieren
standen wir irgendwann vor einer Domain,
bei der wir beide ganz still wurden:
myglobalimpact.earth
Nicht, weil sie besonders fancy war.
Sondern, weil sie exakt das sagte,
was wir eigentlich tun wollten:
Jeder kann seinen eigenen Impact leisten.
Global.
Durch Aufmerksamkeit.
Die Endung .earth kannten wir bis dahin überhaupt nicht.
Wir hatten sie noch nie bewusst gesehen.
Noch nie genutzt.
Aber genau deshalb fühlte sie sich so passend an.
Nicht technisch.
Nicht kommerziell.
Nicht laut.
Sondern:
still groß.
Status am Ende dieser Episode:
Wir warteten noch auf eine Antwort.
Aber das Projekt hörte nicht auf, sich zu formen.
Es bekam gerade seinen ersten echten Namen.
Episode 15 – Wir hatten alles. Nur nicht verbunden.
Der Kauf der Domain war technisch betrachtet kein großer Akt.
Aber organisatorisch ein kleines Minenfeld.
Ich hatte durch eine Übergangsphase mit alter und neuer Webseite meines eigenen Betriebs noch einen freien Hostingplatz bei einem Anbieter. Also lag die Idee nahe:
Kosten sparen, wo es nur geht.
Die Domain haben wir dort gekauft, wo sie am günstigsten war.
Das Hosting wollten wir dort machen, wo ohnehin noch Platz frei war.
Keine zusätzlichen Kosten.
Kein neues Risiko.
Klang logisch.
In der Praxis klang es dann irgendwann so:
„Diese E-Mail-Adresse ist bei uns nicht bekannt.“
Was irritierend war – denn genau an diese E-Mail-Adresse kamen seit Monaten zuverlässig die Rechnungen.
Also begann das, was man in solchen Momenten immer macht:
- Suchen
- Grübeln
- Liste möglicher Alternativ-Adressen im Kopf durchgehen
- Sich selbst misstrauen
Es gab theoretisch die Möglichkeit, dass der Zugang über eine andere Adresse lief. Praktisch war das extrem unwahrscheinlich. Und genau so war es auch.
Die Adresse war richtig.
Der Zugang trotzdem weg.
Damit war für uns schnell klar:
Unabhängig davon, wie dieses Chaos endet –
mit diesem Anbieter wollen wir nicht weiterarbeiten.
Also zurück zu dem Anbieter,
bei dem ich ohnehin schon eine Cloud laufen hatte.
Seit Jahren.
Nie Probleme.
Nie Stress.
Alles funktionierte.
Also wieder neu gedacht:
Domain dort hin.
Hosting dort hin.
Alles an einem Ort.
Wir dachten:
„Jetzt kann’s losgehen.“
Konnte es nicht.
Denn natürlich musste dort erst intern irgendetwas eingerichtet werden.
Konten. Pakete. Zuweisungen.
Also wieder warten.
Als das erledigt war, kam der nächste optimistische Moment:
Ich wollte am Folgetag die benötigten Programme herunterladen,
um mit dem Aufbau der Webseite zu starten.
Und dann kam diese eine Fehlermeldung:
„Sie benötigen eine Domain, um fortzufahren.“
Was objektiv falsch war.
Denn:
- Die Domain war da.
- Das Hosting war da.
- Beides beim selben Anbieter.
Nur:
Beides war nicht miteinander verknüpft.
Wir haben sehr lange den Fehler bei uns gesucht.
In Einstellungen.
In Menüs.
In Optionen, von denen wir nicht wussten, wofür sie da sind.
Bis wir irgendwann doch den Griff zum Telefon gemacht haben.
Support.
Zwei Minuten.
Das Problem war kein technisches.
Es war ein buchhalterisches.
Die Pakete waren getrennt gekauft worden.
Also mussten sie intern auch erst zusammengeführt werden.
Ein kleiner administrativer Umzug – fertig.
Und plötzlich war sie da:
Die Verbindung zwischen Domain und Hosting.
Ab diesem Moment konnten wir wirklich anfangen,
die Webseite zu bauen.
Nicht theoretisch.
Nicht geplant.
Sondern praktisch.
Status am Ende dieser Episode:
Wir hatten Domain.
Wir hatten Hosting.
Wir hatten Geduld verloren.
Und am Ende fehlte nur ein interner Haken an der richtigen Stelle.
Episode 16 – Zum ersten Mal sichtbar
Die Ausgangslage war plötzlich eine völlig andere.
Wir waren nicht mehr davon abhängig,
ob wir irgendwann eine App in einen Store bekommen.
Wir hatten jetzt etwas Eigenes:
Eine Domain.
Einen Ort.
Eine Adresse im Netz.
Sobald wir etwas hatten, das auch nur ansatzweise vorzeigbar war,
konnten wir es veröffentlichen.
Auch wenn es niemand sieht.
Auch wenn es unfertig ist.
Auch wenn es noch kein Produkt im klassischen Sinne ist.
Aber:
Es ist da.
Es existiert.
Und das war ein merkwürdig starkes Gefühl.
Der Brand an sich war zu diesem Zeitpunkt längst entstanden.
Logo, Farben, Grundstil – all das hatte sich schon im App-Prozess herausgebildet.
Unser Logo:
klar, prägnant,
die Weltkugel,
die Abkürzung: MGI – My Global Impact.
Technisch gedacht.
Nicht verspielt.
Eigentlich mussten wir jetzt „nur noch“
das, was wir für die App gebaut hatten,
auf eine Webseite übertragen.
„Nur noch“ ist in solchen Momenten natürlich ein großes Wort.
Also ging es ganz klassisch los:
- Farben anlegen
- Farbbibliotheken bauen
- Grundlayout definieren
Dann der erste kleine Design-Reality-Check:
Unser Logo funktionierte perfekt in der App.
Aber auf der Webseite: nicht.
Der Hintergrundglow war zu weich.
Die Kanten nicht klar genug.
Auf großem Screen wirkte es plötzlich unscharf.
Also:
Logo anpassen.
Glow raus.
Kanten schärfer.
Kontrast härter.
Danach der nächste Punkt:
Ein Hintergrundbild.
Nicht dekorativ.
Nicht emotional.
Nicht „Natur“.
Sondern etwas, das zur technischen Idee passt.
Zur Größe des Themas, ohne Pathos.
Und während sich das Design langsam formte,
kam der pragmatische Teil:
Die Texte.
Keine neuen großen Worte.
Keine Visionen.
Kein Marketing.
Wir haben zunächst einfach das genommen,
was wir ohnehin schon für die App formuliert hatten.
Texte übertragen.
Inhalte übernehmen.
Strukturen anpassen.
Nicht perfekt.
Nicht rund.
Aber:
erstmal da.
Zum ersten Mal war das Projekt nicht nur eine Idee,
nicht nur ein Prototyp auf einem Handy,
nicht nur Code und Konzepte.
Zum ersten Mal war es:
eine echte Website im Internet.
Status am Ende dieser Episode:
Das Projekt hatte jetzt eine Adresse.
Ein Gesicht.
Und einen Ort, an dem es sichtbar sein konnte –
auch ohne Publikum.
Episode 17 – Jetzt braucht es Geld. Kein Applaus.
Als wir die Seite das erste Mal wirklich vor uns gesehen haben –
live, im Browser, nicht nur als Entwurf –
da war da tatsächlich Freude.
Keine euphorische.
Keine pathetische.
Eher diese ruhige, ehrliche Form von:
„Dafür, dass wir das alles nicht können,
ist das hier verdammt ordentlich geworden.“
Ich hatte kurz zuvor für meinen eigenen Betrieb eine neue Webseite machen lassen.
Ich wusste also ziemlich genau,
in welchen Preisregionen sich solche Arbeiten normalerweise bewegen.
Und genau deshalb fühlte sich das, was wir mit unseren sehr begrenzten Kenntnissen gebaut hatten, plötzlich nicht mehr nach „Bastelprojekt“ an –
sondern nach:
„Das hier kann man zeigen.“
Aber genau in diesem Moment kam auch die nächste, sehr nüchterne Realität zurück:
Wir sind hier nicht für Applaus.
Wir sind hier, um etwas zu finanzieren.
Dieses Portal hat keinen Selbstzweck.
Es soll kein Schaufenster sein.
Kein Prestigeobjekt.
Es soll:
Geld erzeugen.
Durch Werbung.
Für Recycling.
Und ohne Werbung gibt es:
- keine Einnahmen
- keine Finanzierung
- keine Weiterentwicklung
- keinen nächsten Schritt
Also kam der nächste logische Punkt auf den Tisch:
Die Anfrage bei Google AdSense.
Formular ausfüllen.
Seite einreichen.
Warten.
Und dieses Warten hatte eine ganz eigene Qualität.
Nicht dieses nervöse, ungeduldige Warten.
Sondern dieses leise:
„Jetzt liegt es nicht mehr in unserer Hand.“
Denn ab diesem Moment war die Frage nicht mehr:
- Können wir das technisch bauen?
- Können wir das gestalten?
- Können wir das erklären?
Sondern:
Darf das hier überhaupt monetarisiert werden?
Vielen Dank.
Status am Ende dieser Episode:
Die Seite war da.
Die Mission stand.
Und die Entscheidung lag plötzlich bei jemand anderem.
Episode 18 – Der einfachste Weg wäre eine Lüge gewesen
Dann kam die Antwort.
Wir wurden abgelehnt.
Die Begründung war kurz und schmerzlos:
Zu wenig Inhalt.
Kein echter Mehrwert.
Aus Sicht von AdSense war das nachvollziehbar.
Unsere Seite war in der Vorfinanzierungsphase.
Wir hatten keine Projekte, keine Fallstudien, keine Ergebnisse.
Wir waren im Aufbau.
Aber genau da lag ja das Problem:
Wir haben nichts vorzuweisen,
weil das Ganze erst noch finanziert werden muss.Und wir können nichts finanzieren,
weil wir ohne Werbung keine Einnahmen haben.Und ohne Einnahmen gibt es auch in Zukunft
nichts vorzuweisen.
Also standen wir da mit einer sehr eleganten Schleife:
Huhn. Ei.
Ei. Huhn.
Je nachdem, wo man anfängt,
kommt man nicht wirklich weiter.
Wir haben viel überlegt.
Hin und her gedacht.
KI befragt.
Der Rat, der immer wieder kam,
war im Kern derselbe:
„Tut einfach so, als hättet ihr schon etwas.
Zeigt ein Beispielprojekt.
Stellt etwas dar, das es noch nicht gibt.
Hauptsache, die Seite wirkt gefüllt.“
Also ein Musterprojekt.
Eine Simulation.
Ein „Prototyp als Realität“.
Technisch gesehen wäre das die einfachste Lösung gewesen.
Aber genau da kollidierte der Vorschlag frontal mit dem,
was wir uns ganz am Anfang vorgenommen hatten:
- Keine Hypothesen als Realität verkaufen.
- Keine Scheinprojekte.
- Kein Marketing-Theater.
- Nur das, was wirklich da ist.
Wenn wir mit einer Lüge einsteigen,
ist die gesamte spätere Transparenz wertlos.
Denn was ist eine „ehrliche Plattform“,
wenn der Einstieg bereits aus einem Fake besteht?
Es wäre bequem gewesen.
Es wäre wirksam gewesen.
Vermutlich hätte es auch funktioniert.
Aber:
Es wäre nicht mehr unser Projekt gewesen.
Also blieb das Problem bestehen.
Keine Projekte.
Keine Werbung.
Keine Werbung.
Keine Finanzierung.
Keine Finanzierung.
Keine Projekte.
Status am Ende dieser Episode:
Wir hatten eine funktionierende Seite,
eine klare Mission –
und ein Werbenetzwerk, das sagte:
„Kommt wieder, wenn ihr mehr zu zeigen habt.“
Nur eins war zu diesem Zeitpunkt schon sicher:
Wir würden eher den schwierigeren Weg gehen,
als das Fundament mit einer Lüge zu gießen.
Episode 19 – Der Moment, in dem wir verstanden haben, was wir wirklich haben
Was an dieser Stelle am meisten frustriert hat,
war nicht die Ablehnung an sich.
Es war der Gedanke dahinter.
Wir wollten das nicht tun,
um uns die Taschen vollzumachen.
Nicht, um schnell Geld rauszuziehen.
Nicht, um irgendwem etwas vorzugaukeln.
Wir wollten:
Etwas Sinnvolles ermöglichen.
Eine Plattform schaffen,
über die Menschen mit minimalem Aufwand
etwas Gutes tun können.
Ohne Geld einzusetzen.
Nur durch ihre Aufmerksamkeit.
Und genau dieser Gedanke wurde blockiert
durch einen automatisierten Prüfzyklus.
Einen Prozess,
dem es völlig egal ist,
- ob jemand gierig ist
- ob jemand ehrlich ist
- ob jemand etwas bewirken will
- oder nur Profit sucht
Für dieses System gibt es nur:
Content oder kein Content.
Mehrwert oder kein Mehrwert.
Freigabe oder Ablehnung.
Kein Mensch schaut sich das wirklich an.
Kein Mensch fragt nach den Motiven.
Kein Mensch entscheidet im Einzelfall.
Und so standen wir da mit einem Projekt,
das etwas bewirken wollte –
und genau deshalb nicht starten durfte.
Natürlich hätten wir auch andere Wege gehen können.
Förderungen.
Anträge.
Programme.
Behörden.
Aber jeder, der jemals versucht hat,
etwas bei einer Behörde zu beantragen, weiß:
Das ist kein Weg für Menschen,
die jetzt etwas bewegen wollen.
Das ist ein Weg für Akten.
Für Fristen.
Für Warteschleifen.
Für Monate.
Oft für Jahre.
Und genau das wollten wir nicht.
Wir wollten nicht Jahrzehnte damit verbringen,
Formulare auszufüllen,
während das eigentliche Problem weiter wächst.
Also ging die Überlegung weiter.
Wie überwindet man ein Startproblem,
wenn man nichts vorweisen darf,
weil man erst etwas vorweisen können müsste,
um überhaupt starten zu dürfen?
Und irgendwann – zwischen all diesen Gedanken –
kam dieser eine, einfache, beinahe banale Einfall:
**Was wir wirklich haben,
ist nicht Geld.
Nicht Werbung.
Nicht Projekte.Was wir haben,
ist unser Weg.**
Wir haben nichts erfunden.
Nichts beschönigt.
Nichts simuliert.
Aber wir haben:
- gezweifelt
- gebaut
- gescheitert
- neu angesetzt
- gelernt
- geärgert
- weitergemacht
Und genau das ist real.
Das ist kein Musterprojekt.
Keine Attrappe.
Kein Fake.
Das ist der tatsächliche Entstehungsprozess.
Und genau in diesem Moment wurde uns klar:
Wenn wir schon nichts vorweisen dürfen –
dann zeigen wir wenigstens,
wie wir bis hierher gekommen sind.
Nicht als Marketing.
Nicht als Heldengeschichte.
Sondern als das, was es ist:
Ein echter Weg.
Mit echten Hürden.
Echten Fehlern.
Echten Umwegen.
Und genau hier,
an genau diesem Punkt,
ist dieser Blog entstanden.
Status am Ende dieser Episode:
Wir hatten noch immer keine Werbung.
Noch immer keine Finanzierung.
Noch immer kein fertiges Produkt.
Aber wir hatten plötzlich etwas,
das niemand ablehnen konnte:
Unsere eigene Geschichte.
Episode 20 – Wir hatten nichts anzubieten. Also boten wir uns selbst an.
Am Ende war es eigentlich ganz simpel.
Das hier war das Einzige,
was wir zu diesem Zeitpunkt anbieten konnten.
Nicht, weil wir es ideal fanden.
Nicht, weil es Teil eines großen Plans war.
Sondern, weil nichts anderes da war.
Und mit etwas Abstand wurde uns noch etwas klar,
das zuerst weh tat –
aber immer plausibler wurde:
Wir sind das Projekt bis hierhin ein bisschen wie Bettler angegangen.
Nicht im moralischen Sinne.
Sondern strukturell.
Unsere Gedanken drehten sich um:
- Marketing
- Reichweite
- Aufmerksamkeit
- Verbreitung
Aber immer nur bis zu diesem Punkt:
„Jetzt bist du auf unserer Plattform –
guck dir ein Video an – danke – bis zum nächsten Mal.“
Und das war zu Ende gedacht.
Denn warum sollte jemand wiederkommen?
Was ist der Grund,
sich nicht einmal umzusehen und dann zu sagen:
„Ja, interessante Idee.
Aber das hier ist ja noch leer.“
Und genau da traf uns die Ablehnung von AdSense noch einmal neu.
Kein Mehrwert.
Sie hatten recht.
Nicht im bösen Sinn.
Nicht arrogant.
Einfach sachlich.
Wir hatten:
- ein Konzept
- eine Vision
- Technik
- Prototypen
Aber:
Wir hatten noch keinen Grund geschaffen,
warum jemand bleiben sollte.
Natürlich hatten wir große Gedanken im Kopf:
- ein ganzes Ökosystem
- mehrere Apps
- vielleicht sogar Spiele
- Zeitvertreib,
- Interaktion,
- eine wachsende Plattform
Aber das war Zukunft.
Und Zukunft bindet niemanden.
Mehrwert entsteht nur aus dem,
was jetzt existiert.
Und genau da lag plötzlich die Antwort direkt vor uns.
Wir hatten ja doch etwas.
Nicht als Produkt.
Nicht als Feature.
Nicht als Funktion.
Aber als Realität:
Unser Weg.
Bis hierhin hatten wir ihn eher versteckt.
Aus Vorsicht.
Aus Angst, man könnte uns etwas wegnehmen.
Aber genau das hatte sich jetzt geändert.
Wir waren online.
Wir hatten eine Domain.
Wir hatten Zeitstempel.
Wir waren öffentlich.
Wir waren die Ersten.
Man kann uns überholen.
Man kann uns kopieren.
Man kann uns technisch abhängen.
Aber niemand kann uns diesen Weg nehmen.
Niemand kann rückwirkend behaupten,
er sei früher hier gewesen.
Und noch etwas kam dazu:
Es sieht uns ja noch niemand.
Die Seite ist öffentlich –
aber ohne Publikum.
Jeder könnte zuschauen,
wie wir weiterbauen.
Wie wir Fehler machen.
Wie wir ändern.
Wie wir nachjustieren.
Aber realistisch tut es niemand.
Das bedeutet:
Wir können dieses Projekt jetzt halb live entwickeln.
Mit offener Tür.
Ohne Zuschauer.
Und genau damit entsteht zum ersten Mal etwas,
das nicht ausgedacht ist,
nicht versprochen ist,
nicht simuliert ist:
Echter, laufender Inhalt.
Kein Musterprojekt.
Kein Fake.
Kein „So könnte es werden“.
Sondern:
So ist es gerade.
Status am Ende dieser Episode:
Wir hatten noch keine Finanzierung.
Noch keine Werbung.
Noch keinen Markt.
Aber wir hatten zum ersten Mal etwas,
das nicht leer war:
Eine Geschichte, die weitergeht.
Episode 21 – Plötzlich öffentlich. Und irgendwie egal.
Die ersten Einträge auf der Webseite zu sehen,
mit meinem Namen darunter,
mit unseren Worten,
fühlt sich… seltsam an.
Nicht aufregend.
Nicht beängstigend.
Nicht groß.
Eher:
Unwirklich.
Es ist mir im Kopf noch nicht wirklich klar,
dass das, was dort steht,
nicht mehr nur für uns ist.
Dass das nicht mehr ein internes Dokument ist.
Keine Notiz.
Kein Entwurf.
Sondern etwas,
das theoretisch die ganze Welt lesen kann.
Ob das heute jemand liest.
Ob morgen jemand darauf stößt.
Oder ob genau in diesem Moment schon jemand hier ist –
darüber mache ich mir ehrlich gesagt kaum Gedanken.
Und vielleicht will ich es auch gar nicht so genau wissen.
Ich versuche einfach,
mit dem, was wir wirklich haben,
diesen Mehrwert zu liefern:
Unsere Geschichte.
Unser Weg.
Unsere Umwege.
Und das Erstaunliche ist:
Es macht mir sogar Spaß.
Es fühlt sich gut an,
endlich erzählen zu dürfen,
was wir so lange für uns behalten haben.
Nicht, weil es geheim war.
Sondern, weil es sich so fragil angefühlt hat.
Man trägt dieses Projekt sehr lange in sich.
Spricht kaum darüber.
Erklärt es niemandem.
Und irgendwann merkt man:
Es ist eigentlich etwas Schönes.
Etwas, das man teilen will.
Und plötzlich darf man es.
In Zukunft wird es sicher auch noch
ein paar Side-Stories geben.
Denn zwischen all den technischen Hürden
gab es auch wirklich absurde,
lustige,
kopfschüttelnde Momente.
Aber jetzt sind wir an einem interessanten Punkt angekommen.
Wir haben die Vergangenheit fast eingeholt.
Bisher war das hier eine rückblickende Erzählung.
Ein Aufarbeiten.
Ein Sortieren.
Jetzt nähern wir uns dem Jetzt.
Es gibt noch ein paar Baustellen:
- Die Startseite ist noch zu schlicht.
- Der Auftritt darf noch klarer werden.
- Ein paar Details fehlen noch.
Vielleicht gibt es noch ein oder zwei weitere Einträge,
die wir aus der Vergangenheit nachreichen.
Und dann kommen wir an diesen Punkt,
auf den wir gerade selbst warten:
- Vielleicht eine Zusage von AdSense.
- Vielleicht eine Rückmeldung des Influencers.
- Vielleicht irgendein Zeichen,
dass es jetzt wirklich losgehen darf.
Und genau da beginnt etwas Neues.
Denn ab dann erzählen wir nicht mehr nur rückblickend.
Ab dann erzählen wir aus der Gegenwart.
Und ab dann kann es passieren,
dass jemand, der das hier liest,
Dinge sieht, die wir übersehen haben.
Gedanken hat,
die wir noch nicht hatten.
Ideen einbringt,
auf die wir selbst nicht gekommen sind.
Und genau das ist auch gewollt.
Wir sind offen für alles,
was dieses Projekt besser machen kann.
Ohne falschen Stolz.
Ohne Rechthaberei.
Ohne Abwehr.
Denn wir bauen hier nichts Fertiges.
Wir bauen hier etwas Lebendiges.
Status am Ende dieser Episode:
Wir sind fast in der Gegenwart angekommen.
Und plötzlich ist dieses Projekt nicht mehr nur unseres.